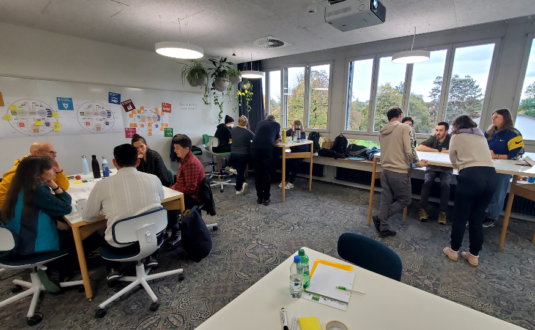Milch: Echt starke Propaganda
Die Milchbranche hatte in der Schweiz lange einen hervorragenden Ruf. Nun beginnt das Image der Milchindustrie zu bröckeln. Gründe dafür gibt es viele.
«Wusstest du, dass Schweizer Kühe zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft dazugehören?», fragt Swissmilk auf einer aktuellen Kampagnen-Webseite. Swissmilk, das ist der Marketing-Arm der mächtigen Dachorganisation der Schweizer Milchproduzenten. Das Ziel des nationalen Marketing-Efforts: die Konsumierenden davon überzeugen, dass Schweizer Kühe den Boden pflegen, die Biodiversität fördern und zur CO2-Reduktion beitragen.
Nur, tun sie das wirklich?
Da fehlt doch was…
Über 80 Prozent des schweizweiten Methanausstosses stammt von Kühen. Wenn diese ihr Futter verdauen, entsteht das potente Gas, das in der Atmosphäre 25 Mal stärker zur Klimaerwärmung beiträgt als Kohlendioxid. Von einem Beitrag zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft kann bei der schieren Anzahl Kühe in der hiesigen Viehhaltung also nicht die Rede sein.
Was der Swissmilk-Kampagne fehlt, sind verschiedene Klarstellungen und eine angemessene Differenzierung. Neben den offensichtlichen Problemen wie den Methanemissionen blendet die Kampagne weitere, essentielle Faktoren bewusst aus, u.a. die Anzahl und Rasse der Tiere sowie deren Fütterung.
Die Masse machts
In den Swissmilk-Werbungen lacht uns die Kuh «Lovely» entgegen. Eine glückliche Kuh mit Hörnern, die praktisch alleine auf einer grossen, grünen Weide grasen darf. In der Realität sieht die Kuhhaltung hierzulande aber ziemlich anders aus.
In der Schweiz leben zu jedem Zeitpunkt fast 1.5 Millionen Kühe – das sind für ein so kleines Land sehr viele. So wie Lovely sehen die wenigsten aus, denn 90 Prozent der Kälber werden enthornt. In unserer Vorstellung grasen all diese Tiere auf der Alp und bilden damit eine wertvolle Ressource, weil sie für uns nicht-verwertbares Gras in Nahrung umwandeln.
Fakt ist allerdings: Es gibt so viele Kühe in der Schweiz, dass man sie unmöglich alle mit Schweizer Weidefutter ernähren kann. Und was die Tiere nicht auf unseren Weiden finden, muss zugefüttert werden. Dazu wird sogenanntes «Kraftfutter», oftmals Soja und Mais, vornehmlich aus Übersee in die Schweiz geschifft. Dieses Futter ist für die Milchproduzent:innen wichtig, weil es für hohe Milchleistungen sorgt und damit eine Effizienzsteigerung bedeutet. Weltweit wird ein ganzes Drittel des Getreides an Tiere verfüttert.
Für die Produktion dieser Futtermittel werden enorme Flächen benötigt, die oftmals durch Rodungen freigemacht werden. Ein signifikanter Teil der brasilianischen Amazonas-Rodungen korreliert deshalb direkt mit dem Futtermittelbedarf in Ländern wie der Schweiz.
Futtermittel werden aber auch hierzulande angebaut. Und auch bei uns sorgt das für einen enormen Fussabdruck, weil die betroffenen Felder knapp 50 Prozent sämtlicher Ackerflächen ausmachen. Kurzum: Die Hälfte des Schweizer Ackerlandes wird für Tierfutter genutzt anstatt Nahrung für uns Menschen zu produzieren!
Unsere Kühe sind nicht mehr dieselben
Neben der Masse zählt auch die Rasse: Durch gezielte Zucht hat sich die Milchleistung von Schweizer Kühen seit Mitte des 19. Jahrhunderts mehr als verdoppelt, was zur Folge hatte, dass die Tiere immer wie grösser und schwerer wurden. Für die Weiden, v.a. in den Bergen, sind sie durch das hohe Gewicht deshalb ungeeignet.
Einheimische Rassen, die sich über Jahrhunderte an die klimatischen und topographischen Gegebenheiten angepasst hatten, wie beispielsweise das Grauvieh im Kanton Graubünden, existieren heute kaum mehr, weil sie für unser System nicht effizient genug sind. Die heutigen Hochleistungsrassen sind auf Kraftfutter angewiesen, da ihnen die Weide nicht genügend Nährstoffe und Futtermenge liefert.
«Nachhaltige» Milch und die Alternativen
Diese Fakten sind keine Neuigkeiten für die Milchindustrie, die sich der negativen Ökobilanz ihrer Produktkette durchaus bewusst ist. Immer wieder werden deshalb «Innovationen» aus der Industrie präsentiert, die als «grün» oder «nachhaltig» gelabelte Produkte umwelt- und tierwohlbewusste Konsument:innen dazu bewegen möchten, ihren Kaffee weiterhin mit Kuhmilch zu trinken. Diese Produkte sind zwar teils besser, vermögen die fundamentalen Probleme der Milchproduktion allerdings höchstens oberflächlich zu überwinden.
Die grosse Innovation geschieht ausserhalb der Ställe: die pflanzlichen Alternativen zu Kuhmilch boomen, der Absatz steigt Jahr für Jahr. Eine Studie des WWF Schweiz hielt 2020 fest, dass pflanzliche Drinks aus Soja, Hafer oder Dinkel einen deutlich geringeren Klima-Fussabdruck als Kuhmilch haben. Hafermilch emittiert beispielsweise 69 Prozent weniger Treibhausgase – und das erst noch, ohne klimaschädliches Methan zu produzieren. Der Energieverbrauch ist zudem 61 Prozent und der Landverbrauch gar 89 Prozent tiefer.
Auch beim Schweizer Detailhandel ist diese Entwicklung spürbar. Die Migros reagiert und bringt beispielsweise unter dem Label «V-Love» regelmässig neue Produkte auf den Markt, die mit den milchbasierten Originalen konkurrieren. Die Kundschaft wächst – und damit die Sorge der Milchproduzent:innen.
Ökologie? Fehlanzeige!
Es ist nicht zu bestreiten, dass Milch und Milchprodukte die Schweizer Kultur durch jahrhundertelange Ernährungsgewohnheiten mitgeprägt haben. In Zeiten der Überzüchtung, der unverantwortlichen Kraftfuttererzeugung und weit überschrittenen Herdengrössen erweist sich die Ökologisierungs-Kampagne von Swissmilk allerdings als misslungener Rettungsversuch einer angegriffenen Industrie.
Und eine solche Irreführung der Konsumierenden ist vor allem eines: echt schwach.